-
-
- Technische Details
zu alten
- Walzen-Spieldosen
1796
- 1900
-
|
- Erste
Seite
|
- Die
meisten Fotos lassen sich
- durch Anklicken vergrößern
-
|
|
-
-
-
- Hersteller
Walzen- Zylinder-
Spieldosen
-
|
- Ami Rivenc (Genf)
|
- Langsdorff (Genf)
|
- Baker-Troll (Genf)
|
- Lassueur, Auguste (Sainte
Croix)
|
- Bendon, George (Genf)
|
- LeCoultre & Riviere (Genf)
|
- BH Abrahams - BHA (Sainte
Croix)
|
- LeCoultre Freres (Genf)
|
- Bremond, BA (Genf)
|
- Mermod Frères (Sainte Croix)
|
- Conchon & Cie (Genf)
|
- Mojon Manger (Genf)
|
- Cuendet, Abraham-Louis (L´Auberson)
|
- Nicole Frères (Genf)
|
- Dawkins (Genf)
|
- Olbrich Anton + Josef (Wien)
|
- Ducommun Girod (Neuchâtel, später
Genf)
|
- Paillard (Sainte Croix)
|
- George Baker & Co (Genf)
|
- PVF (Sainte Croix)
|
- Greiner (Genf)
|
- Reuge Sainte Croix (Schweiz)
|
- Grosclaude (Genf)
|
- Rzebitschek (Prag)
|
- Heller, Johann Heinrich (Bern)
|
- Soulale, Andre (Paris)
|
- Jérémie Recordon (Sainte Croix)
|
- Thorens, Hermann (Sainte Croix)
|
- Junod, Samuel + Arthur
(Sainte Croix)
|
- Troll, Samuel (Genf)
|
- Karrer (Genf)
|
- Ullman, Charles (Schweiz)
|
- L' Epée Schweiz (Sainte Suzanne/Frankreich)
|
- Vidoudez, Henri (Sainte Croix)
|
- Lador SA (Sainte Croix)
|
- Willenbacher & Rzebitschek
(Prag)
|
-
|
-
-
-
-
-
- Original-Ton
dieses Instruments anhören

|
- Eine
typische
Walzenspieldose
- des
Herstellers
- Mermod Fréres um 1895
- aus
Sainte Croix /Schweiz
-
- Peerless Forte-Piccolo No. 370
- Tonkamm
mit 80 Tonzungen.
- 6 Liedtitel
gestiftet.
-
- Walzenlänge:
22,8 cm
- Walzendurchmesser: 5,5 cm
- Walze wechselbar
(Interchangeable)
-
- Mehr
zu DIESER Spieldose finden
- Sie hier.
|
-
- Über dem Tonkamm, sieht man einen
sog. "Zither-Effekt". Über
einen Hebel an der (roten) Lyra wird eine
simple Seidenpapier-Rolle leicht auf die schwingenden
Tonfedern gedrückt. Dadurch ergibt sich
ein "schwirrender Zitherähnlicher"
Klang der auch als Mandolinenklang bezeichnet
wurde.
Ähnlich dem Kinderspielzeug-Effekt:
Seidenpapier vor einen Kamm halten und hineinsummen.
Dieser wirkllich interessante "Zitherklang" ist natürlich abschaltbar.
-
- Auf
der rechten Seite befindet sich die Funktion
"Jacot´s Patent Safety-Check".
- Diese Erfindung verhindert den gefürchteten
"Run". Dieser
tritt u.a. bei einem Defekt der Fliehkraftbremse
/ Fliehkraft-Regler auf. Ein "Run"
führt häufig zur totalen Zerstörung einer
Walzenspieldose.
-
- An
der linken Seite der Walze befindet sich
ein Liedanzeiger. Dieser läuft beim
Abspielen der Musiktitel automatisch mit und zeigt
die Titelnummer des gerade gespielten Liedes
an. Hier kann auch eine bestimmte Liednummer
vorgewählt werden, sodass nur dieser Titel
abgespielt wird. Eine sehr praktische Funktion
!
-
- Das
Instrument wird hier - im Gegensatz zum
sonst üblichen linksseitigen Ratschenaufzug
-
mittels einer Kurbel an der rechten
Seite aufgezogen. Der
Zylinder
und die Mechanik sind vernickelt. Das Werkgestell
ist aus Eisen, gerippt und bronziert. Gehäuse aus
Nadelholz, Oberfläche
in der typischen Rosenholz-Immitation.
- Abmessungen:
50 x 23 cm
- Höhe 17,5 cm
|
-
-
-
- Die
Wiege der Walzenspieldose stand in der Schweiz
-
- Spieldosen
1796 - 1820
-
- Die
Erfindung der Musikdose geht auf den Genfer Uhrmacher Antoine
Favre-Salomon (1734-1820)
zurück,
- welcher
1796
das Prinzip der klingenden Stahllamelle beschrieb.
-
- Er präsentierte der Genfer "Société des Arts" eine neue Machart des Musikwerks,
das "zwei Melodien spielt und den Klang der Mandoline imitiert, eingebaut in
den unteren Teil einer Tabatière normaler Grösse."
-
- Seine Erfindung basierte auf einer rotierenden Walze mit Stiften, die an
dünnen Stahllamellen zupfen. Das Prinzip wurde überall gelobt; trotzdem hatte
er keinen Erfolg damit. Er gab seinen Beruf später auf und starb in ärmlichen Verhältnissen.
Andere bauten darauf auf, sodaß im Jahr 1802
Jean-Frédéric Leschot Fingerringe mit einem eingebautem
- Lamellenmusikwerk nach Favres
Prinzip beschrieb. Hersteller war aber nicht Leschot, sondern Isaac-Daniel Piguet,
ein
Uhrmacher aus dem Vallée de Jou.
-
-
In Genf arbeitete dieser zunächst für Leschot, dann zusammen mit seinem
Schwager
- Henri Capt ab 1802 und mit
- Samuel Philipp Meylan ab 1811.
-
- Viele weitere spektakuläre Objekte gingen aus Piguets Werkstatt hervor.
- Favres Prinzip
wurde zunächst in Fingerringen und anderen Schmuckstücken benutzt, wobei
ausschliesslich Musikwerke mit sehr wenigen Tönen hergestellt wurden.
|
|
|
-
-
Erst ab 1813 produzierte man auch Musikwerke für Tabatièren oder Schmuckdosen,
die einen grösseren Tonumfang aufweisen konnten. In einem weiteren
Schritt wurde Favres Prinzip auch auf die eigentliche Musikdosen ohne weitere
Funktion übertragen.
-
-
- Die
Spieldose - wie wir sie heute kennen - wurde also ab etwa 1815
so hergestellt.
- Es entstand eine neue Bauform von Musikwerken,
welche in Kamin- und Wanduhren eingebaut wurden. Das sog. Cartel.
Damals war es eine Bezeichnung für den Sockel einer Wanduhr-
wurde aber später zu einem Begriff der größeren Musikwerke an sich.
- Kleine
Walzenspieldose
um 1820. Drei Tonzungen in Gruppen angeordnet.
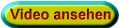
-
-
-
- Um 1832 ist die Musikdosenindustrie fest in Sainte-Croix etabliert.
17 Fabrikanten beschäftigten damals 360 Arbeiter. Daneben gab es rund neunzig Uhrmacherbetriebe.
- Eine eigene Seite zur Spieluhren-Metropole in Sainte-Croix
finden Sie hier

-
- Im
Zentrum der Spieldosenindustrie - in Genf und
Sainte Croix - werden um 1813
- ca. 3000 Stück produziert.
Das
Wachstum dieser neuen Industrie ist ganz erstaunlich.
- 1827 werden
bereits mehr als 16500
Spieldosen hergestellt.
|

-
- Beispiel für
ein kleines
- Zylinder-Musikwerk
- um
1820
- mit einzeln aufgeschraubten
- Tonzungen
in Gruppen.
|
-
-
-
|
|
 Sehr frühe Walzenspieldose um 1820
Sehr frühe Walzenspieldose um 1820 - mit je
zwei Tonzungen pro Gruppe.
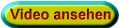
|
- Klick
auf diie Fotos zum Vergrößern
|
-
-
- Mitte des Jahrhunderts wuchs die Produktion von Musikdosen sogar
auf rund
35000 Stück jährlich, wovon ein Grossteil ins Ausland exportiert wurde.
- Einzelne Fabrikanten waren sehr schnell erfolgreich.
Sie wurden zu wichtigen Arbeitgebern der Region. Zunächst fertigte man die
Automaten in dezentraler Heimarbeit. Mitte des 19. Jh. wurde diese Art der Produktion immer mehr
durch kleinstädtische Manufakturen abgelöst.
-
- Die Pionieren waren z.B. Abraham-Louis Cuendet, Henri Jaccard, Samuel
Junod, Louis Mermod, Moïse Paillard
- oder Jérémie Recordon.
-
-
 Die Glanzzeit der Musikdosenindustrie waren die Jahre 1875 bis 1896.
Die Glanzzeit der Musikdosenindustrie waren die Jahre 1875 bis 1896.
- Ca. 30 Firmen waren in Sainte-Croix und Umgebung tätig.
Bekannte Namen waren:
- Lassueur, Reuge, Thorens, Mermod, Paillard und Vidoudez in
Sainte-Croix und Cuendet in L’Auberson.
-
- Eine
weltweite Wirtschaftskrise zwischen 1875
- 1880 unterbrach diesen
Trend abrupt. Die zweite Wachstumsphase setzte um 1878
ein und intensivierte sich ab ca. 1881.
- Bereits
1887
ging über ein Drittel des gesamten Spieldosen-Exports
nur in die USA. Innerhalb von nur 11 Jahren - zwischen 1883
- 1894 - verdoppelte sich
die Jahresproduktion von 100
000 auf 200 00 Stück (!)
-
-
- Antique 5-Bell Cylinder Music Box von
Paillard um 1885
|
|
-
 Am
Ende des 19. Jahrhundert kündigt sich erneut eine große Krise
an.
Am
Ende des 19. Jahrhundert kündigt sich erneut eine große Krise
an.
- Ab 1896
beginnt die Nachfrage nach Spieldosen rapide zu sinken, der
Untergang einer spezialisierten Industrie steht bevor. Der Grund
lag darin, dass die Schellackplatte
im Oktober 1896 - abspielbar mit einem Grammophon - erfunden
wurde !
-
-
-
 Die
meisten Fotos lassen sich durch Anklicken vergrößern
Die
meisten Fotos lassen sich durch Anklicken vergrößern -
-
- Jede
Tonzunge mußte einzeln
angefertigt, gestimmt
und
- dann auf den Zungenbalken aufgeschraubt werden.
-
- Wie man
sich denken kann, war das eine recht mühselige Arbeit.
|
- Beispiel für
einzeln
- aufgeschraubte Tonzungen
- Schlüsselaufzug
- Kraftausgleich mittels
- Schneckenrad
und Kette.
- Zylindermasse:
164 x 33 mm - 3 Melodien
- 86
einzeln aufgeschraubte Tonzungen.
- Die
Basstöne sind hier links
- und
rechts aussen,
- welches
den V-förmigen Kamm bedingt.
-
- >
Hergestellt in Genf um 1818 <
|
|
-
-
- Beispiel für
Tonzungen in
Segmenten aufgeschraubt.
- Uhrensockel
m. Musikdose
- 92
Töne in 2er Segmenten
-
- >
Genf
um 1823 <
|
|
- Wenige
Jahre später - ab ca. 1821 - gelang es aber vier bis fünf Tonzungen aus
einem Stück Stahlblech
anzufertigen.
Das stellte eine große Verbesserung dar.
-
- Der Tonkamm
bestand hier aus einzelnen kleinen Tonkämmen, also völlig separaten
Segmenten.
|
-
- Bereits
1810 gelang es einem Genfer
Hersteller mittels einer speziellen Fräsmaschine den Spielkamm
aus einem Stück Stahl herzustellen.
-
-
- Was
ist eigentlich ein Tonkamm?


- Er
ist ein Objekt aus Stahl in der Form eines Kammes mit abgestuften
Zähnen von kurz nach lang. Diese Zähne dienen als Tonzungen.
Jede Tonzunge wird auf einen ganz bestimmten
Ton gestimmt. Zum Beispiel: C,
Cis D, Dis, E, F usw.
-
- Mit
zunehmend tieferem Tönen vergrößerte sich die Länge der Tonzungen.
Für Basstöne
ergaben sich so unhandlich lange Zunge, so daß man die Spielwerke
in sehr großen Kästen hätte unterbringen müssen.
-
- Die
rettende Lösung bestand im Anlöten von massiven Bleigewichten unter den Zungen
der tieferen Töne. Damit ließ sich die Zungenlänge bedeutend verkürzen. Eine techn. Lösung,
welche von jetzt an immer angewandt wurde.
-
|
- Unterseite eines Tonkamms !
-
- Gelber
Pfeil = angelötetes Bleigewicht
-
- Roter
Pfeil = Dämpferfeder
aus Federstahl
- Für
mittelgroße Spieldosen -> Federbandstahl
0,05 mm, ca. 0,4 mm breit.
-
- Grüner
Pfeil = Konischer Stift zum
Festhalten der Dämpferfeder
|
-
 Tonzungen abgebrochen ?
Tonzungen abgebrochen ? - Die
Stahlstifte des sich drehenden Zylinders
berühren für einen kurzen Moment jede
dieser Tonzungen und bringen diese in Schwingung, wodurch Töne
hörbar werden und somit eine Melodie
entsteht.
-
- Abgebrochene
Tonzungen sind also nicht so leicht zu ersetzten, da man den genauen
Ton
kennen muss auf welchen gerade diese Zunge ursprünglich gestimmt
war. Außerdem sollte die Stahl-Legierung möglichst genau dem
Original entsprechen.
-
- Die Tonzungen sind
auch nicht in der Art einer
Tonleiter wie bei einem Klavier gestimmt
(!) Restauratoren müssen
hier also viel Erfahrung und am besten
eine musikalische Grundausbildung mitbringen.
|
-
-
- Fotos
der Unterseite eines Tonkamms
- mit
Dämpferfedern und Bassgewichten
 Alle Fotos lassen sich durch Anklicken vergrößern
Alle Fotos lassen sich durch Anklicken vergrößern

-
-
-
-
-
- Stiftwalzen


- Stiftwalzen haben den
Vorteil,
dass man sie seitlich verschieben kann. Das ermöglicht das Aufzeichnen
von mehreren Melodien auf derselben Walze.
-
- Ursprünglich
sah man für die Stiftwalzen ein dünnes Messingrohr vor. Bei
den allerersten Spieldosen hatten die Stifte eine konische Form
und steckten ohne weiteren Halt in den Löchern des Zylinders
fest.
-
- Bald
entwickelte man eine wirtschaftlichere Methode. Man verwendete
Stahldraht vom genauen Durchmesser der Löcher wobei man das
Einführen durch konisches Anfeilen erleichterte.
-
- Hatte
man die Stifte schon vorher zugeschnitten, so presste man sie
mit einer Poussette in die Löcher und befestigte sie, indem
man eine dünne Schicht Schellack
in den Zylinder goss. Diese
Schellack Schicht im innern des Mesingzylinders wirkte sich auch
sehr positiv auf das allgemeine Klangbild aus. Die Töne klangen
durch die höhere Masse deutlich voller.
-
- Zum
Festsetzten der Stifthöhe montiert man den Zylinder auf seiner
Achse auf einer Drehbank. Mit Hilfe von Feile
und Schleifstein, stutzte man die Stifte bis alle die richtige
Höhe hatten.
-
|
- Schon
ein winziger Unterschied von 3/100
mm wirkt sich auf das Anzupfen
der Tonzungen aus.
-
-
- Insgesamt eine Arbeit von
grösster Präzision. Die
einzelnen Liedtitel sind im Abstand von ca.
0,4 mm auf der Walze
gestiftet.
-
- Ist
ein Lied zuende gespielt, bewegt sich der Zylinder also um 0,4
mm nach rechts
um das nächste Lied zu spielen, was höchste mechanische Präzision
erfordert.
-
- Diese
Stahl-Stifte haben oft einen Durchmesser von nur 0,3
mm (!) und stehen nur ca. 1
mm (!) von der Walzenoberfläche
hervor.
-
- Die Anzahl der benötigten
Stifte schwankt je nach Größe und Durchmesser eines Zylinders
von 100 bis zu 30000 manchmal
sogar 40000
Stück
!
-
|
|
-
- Wie
schon erwähnt, goss man mehr Schellack in den Zylinder
als nötig war, um die Stifte zu befestigen, so verbesserte das
den Klang erheblich. Der
Zylinder tönte nicht mehr so spröde, womit unerwünschte Resonanzen
gemeint waren. Und die Bässe wurden verstärkt da der Zylinder
den Masse-Effekt der Platine unterstützte.
- Auch "streckte" man die Füllmasse mit Stein- oder Ziegelstaub
-
eine Mischung, die man damals auch als "Zement" bezeichnete.
-
- Ein
großer Nachteil der Walzenspieldosen
bestand jedoch in ihrem begrenzten Musikrepertoire.
-
- Meistens spielte
eine Walze 4 bis 6 Musiktitel. Da die Walzen - bis auf Ausnahmen
- nicht austauschbar waren,
musste man, war man der Musik überdrüssig - eine neue Spieldose
kaufen.
- Ab 1885/86 erfand man aber die Plattenspieldose
mit leicht wechselbaren und billig herzustellenden Metall-Platten. Damit war zwar
dieses "Problem"
beseitigt.
-
- Diese neue Erfindung führte allerdings zum raschen Niedergang der
Walzenspieldosen-Industrie
(!)
-
-
- Walzenspieldosen
ab 1820
- Ab
etwa 1820 wurden Walzenspieldosen in der Form gebaut, wie wir
sie
heute kennen. Sie sind an ihrem schlichten Gehäuse aus Nadelholz zu erkennen,
das oft nicht mal ordentlich furniert ist.
- Eine
Datierungstabelle zu alten
Walzen- Spieldosen finden Sie hier ->

-
- Der
Kamm besteht nicht aus einem Stück, sondern aus einzeln
verschraubten Zähnen
und später aus Gruppen von
- 2 - 5 Zähnen. Vor
1820 ist der bekannte einteilige
Kamm nur selten zu finden, ab etwa 1850 aber wird nur noch der einteilige Kamm Standard.
-
|
-
|

|
- Frühe
Le Coultre Musik Box
- 6
Musikstücke Schlüsselaufzug
|
-
|
- Frühe
Le Coultre Musik Box um 1840
- 6
Musikstücke. Schlüsselaufzug
|
-
- Die
Walzenspieldosen aus dieser Zeit zeichnen sich durch kleine
Gehäuse aus, welche kaum größer als das Spielwerk sind.
Die Walzen sind meistens für vier, maximal sechs Musikstücke
gestiftet.
- Die Grundplatte besteht aus
poliertem Messing.
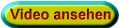
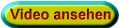
-
-
-
- Walzenspieldosen
ab 1840
- Um etwa
1840 begann die industrielle
Fertigung von Walzenspieldosen. Infolge der Konkurrenz wurden
bedeutende Verbesserungen eingebaut - wie zum Beispiel Glocken
und Trommeln.
-
-
- Zu
Beginn wurden diese "Zusatzinstrumente"
versteckt unter dem Spielwerk eingebaut.
-
- Später waren sie dann
auch sichtbar
- und oft hinter der
Walze angebracht.
|
- Frühe
Nicole Freres Spieldose mit "versteckter"
Instrumentierung
- um 1850.
- Trommel
+ Kastagnette
- + 6 Glocken.
- 4 Musiktitel
gestiftet.
|
-
-
|
|
-
-
|
|
- Spieldose
mit 10 versteckten Glocken
- und
versteckter Blechtrommel.
-
- Rätschenhebel,
Zylinder 384 x 54 mm, 6 Melodien,
- Kamm
m. 106 Tönen, 10 Glocken m. 17 Schlegeln,
- 1
Blechtrommel (links) m. 10 Schlegeln.
- Alles
unter der Platine angeordnet.
-
- Alliez &
Berguer - Genf um 1855
|
-
-
-
 Fünf
Klangbeispiele kleinerer Walzenspieldosen
Fünf
Klangbeispiele kleinerer Walzenspieldosen
-
|
- Allegro
Menuett von Mozart
|
|
- Die
Vier Jahreszeiten von Vivaldi
|
|
- Gavotte
Menuet von Mozart
|
|
- Rigoletto
Aida von Verdi
|
|
- Wiener
Leben von Strauss
|
|
-
-
|
- Was
ist eine Malteserkreuz-Stellung
- für
Uhren und Spieluhren ?
|
-
-
- Malteserkreuz-Getriebe
werden u.a. im Uhrenbau und bei Spieldosen eingesetzt.
- Es ist eine Erfindung
aus dem 17. / 18. Jahrhundert welche speziell bei kleineren Spieluhren
eingebaut wurde.
-
- Sie dienen zur Begrenzung der Aufzug-Umdrehungs
Anzahl der Aufzugsfeder am Anfang und am Ende.
-
- Wenn
Zugfedern damals zu weit aufgezogen wurden, dann strotzten sie für kurze Zeit nur so
vor Kraft und brachen dann manchmal ab.
-
- So
wurden Mechanismen erfunden, die die Zugfeder davor
bewahren sollten zu weit aufgezogen zu werden. Außerdem arbeitet die Zugfeder
dann in einer gleichmäßigeren Kraftkurve wenn
der Anfang und das Ende beim Aufziehen weggelassen
wird.
-
- Die
Feder arbeitet dann nur in einem Bereich, in dem ihre Federkraft nahezu
linear ist. Auch kann sie nicht mehr übermäßig aufgezogen werden.
-
- Hierzu
fehlt einer der Schlitze oder kreissektorförmigen Ausnehmungen im
sog.
Malteserkreuz. Dadurch wird die Zahl der möglichen Umdrehungen begrenzt.
-
- Die
Anzahl der Schlitze im Malteserkreuz/Sternrad kann unterschiedlich sein. Bei Uhren werden
meistens fünf Schlitze verwendet. Es
gibt auch Ausführungen wobei das Malteserkreuz eine völlig andere Form haben
kann.
-
|
|
-
- In
das Sternrad (Malteserkreuz) greift
ein Rad mit einem "fingerförmigen"
Hebel ein, der sich
beim
Aufziehen der Feder weiter dreht
und
das Malteserkreuz bewegt.
- Leider
wurde sehr oft dieses Rad
mit "Finger" bei alten
Spieldosen entfernt, um
auch noch den letzten Kraftrest der
Zugfeder auszunutzen. Letztendlich ein großer
Nachteil und Wertverlust
bei alten Spieldosen/Spieluhren.
|
-
|
-
-
- Walzenspieldosen
ab 1870
- Ab
1870 wurde die polierte
Messinggrundplatte durch eine gerippte
Gußeisenplatte abgelöst,
welche
mit Bronze- oder Silberfarbe angestrichen wurde.

-
-
-
- Oberfläche
in typischer
- "Rosenholz" Imitation
- für
einfache Walzenspielkästen.
- Zu
hunderttausenden hergestellt.
|
- Die
Holzkästen bestanden normalerweise aus billigem Nadelholz. Die Oberflächen
der teureren Modelle wurden jetzt aber furniert
und aufwändig mit Einlegearbeiten versehen.
-
- Bei
vielen der einfacheren Holzkästen versah man die Oberflächen
mit einer Art "Rosenholz-Imitation".
-
|
-
- Oberfläche
aufwändig furniert
- mit
Einlegearbeiten
- für
teure Walzenspielkästen.
|
-
-
-
-
-
- Forte-Piano
Spieldosen und deren Varianten ab 1840
-
- Mit der Technik der Forte-Piano Spieldosen ließ sich die Lautstärke einer
Musikdose variieren.
- Man setzte mehrere Tonkämme aus weicherem oder härterem Stahl ein oder
arbeitete mit kurzen und langen Stiften auf den Zylindern, was ebenfalls
unterschiedlich laute Klänge ergab.
Solche Objekte mit Lautstärken-Dynamik wurden als Forte-Piano
Musikdosen
bezeichnet und waren zwischen 1840 und 1875 recht beliebt.
|
- Forte Piano Spiedosen
- Nicole Freres
-
|
-
-
 Für
die Lautstärke-Dynamik gab es verschiedene Möglichkeiten !
Für
die Lautstärke-Dynamik gab es verschiedene Möglichkeiten !
-

|
- Piano-Forte
Spieldose
- Zwei
Tonkämme.
- 4
Melodien - 111 Forte
- und
58 Piano Tonzungen.
- Fa.
Metert & Langdorff
-
- >
Genf um 1848 <
|
- 1.
Durch kurze Stifte beim leisen (piano) und lange
Stifte beim lauten (forte) Kamm. Das
bewirkte natürlich ein unterschiedlich starkes Anzupfen
der
Tonzungen.
-
- Die
Kämme werden abwechselnd gespielt, was beachtliche Klangeffekte
ergab. Bei besonders lauten Stellen des Musikstücks ließen sich
beide Kämme zugleich anreißen. Um ein exakt gleichzeitiges
Ansprechen zu erreichen, war eine besonders präzis ausgeführte
Bestiftung nötig.
-
- 2.
Beide Tonkämme werden durch gleich lange Stifte auch gleich
stark angezupft. Der leise/piano Tonkamm hat aber leichtere
Bleigewichte und dünnere Zungen, deshalb klingt er etwas leiser.
-
- 3.
Diesen
Spieldosen-Typ gab es häufig auch mit nur einem Kamm, das Prinzip
war das gleiche.
- Die Tonzungen werden von langen und kurzen
Stiften unterschiedlich stark angezupft, wodurch leise und laute
Töne entstehen. Die Herstellung dieser Stiftzylinder mit unterschiedlichen
Stiftlängen war ausgesprochen aufwendig (!)
-
 Die
meisten Fotos lassen sich durch Anklicken vergrößern
Die
meisten Fotos lassen sich durch Anklicken vergrößern
-
- Orchseter-Spieldosen
mit zusätzlichen Instrumenten ab ca. 1855
-
-
- Orchester
Spieldose mit einem Harmonium
- und
Zungenpfeifen.
-
- Neun
Glocken und eine Trommel. Siehe Video.
-
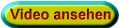
-
|
|
- Orchester-Spieldose
- 6
Glockenhalbschalen,
- Glockenhämmer als Chinesen,
- Trommel u. Kastagnette,
- 2x Zither-Effekt
und
- pneumatische Harmonika.
-
- Schweiz/Genf um 1890
|
-
- Ab
etwa 1855 wurden in die Musikdosen
noch weitere zusätzliche Instrumente eingebaut. Dem
Erfindungsgeist waren kaum Grenzen gesetzt.
-
Schon um 1860 kamen vermehrt raffinierte Konstruktionen mit zahlreicher
Instrumentierung zum Einsatz, welche man auch Orchesterspieldosen
nannte. Es
kamen kleine Trommeln (Snare-Drums) , Orgelpfeifen,
Glocken, Kastagnetten Pauken und vieles mehr hinzu.
- Beonders
beliebt war der Einbau eines zusätzlichen Glockenwerks. Die
Glocken - meist in Halbschalenform - wurden von einem separaten
Kamm -
ebenfalls über die
Walzenstifte - gesteuert.
- Manchmal
waren es bis zu zwölf und mehr Glocken.


-
-
- Spieldose
von George Bendon/ Schweiz um 1890 mit 9 Glocken
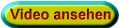
|
-
- Orchester
Spieldose von Paillard/ Schweiz um 1880.
- 7 Glocken, Trommel,
Kastagnette, 12 Titel
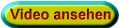
|
-
-
-
-
- Orchester
Spieldosen
-
 Klick
auf die Fotos zum Vergrößern
Klick
auf die Fotos zum Vergrößern
|

|

|
- Walzenspieldose
mit 7 Glocken. Glockenhämmer
- in
Schmetterlingsform, auswechselbare Walze,
- Zither-Effekt-Mechanik, Ratschenaufzug.
|
- Walzenspieldose
mit 6 Glocken
- Glockenhämmer
in Schmetterlingsform
|
-
|
-
|
- Walzenspieldose
mit Glocken,
- Trommel
und Liedanzeiger.
- Glockenhämmer
als Chinesen
|
- Kleine
Orchesterspieldose
- 8
Musiktitel - 43 Tonzungen
- Trommel
+ 3 Glocken
|
-
- Walzenspieldose
mit 6 Glocken und den beliebten Chinesen
- als Glockenschläger sogar mit einem beweglichem Kopf.
-


|


-
- 2
Videos
- "Chinesen
als Glockenschläger"
|
|
-
-
- Weitere
Walzenspieldosen mit Glockenwerk gibt es hier
 zu sehen
zu sehen
-
-
|
-
-
- Voix Célestes / Zungenpfeifen / Luftinstrumente
-
-
-

|
- Die
Kombination
mit dieser - auch Harmonika
genannten - Einrichtung war
- recht
erfolgreich, wenngleich
man sie heute im handelsüblichen Angebot alter
- Spieldosen nur noch selten findet. Auch diese
Modelle sind natürlich sehr hochpreisig !
-
 Excellente
Orchester Spieldose von George
Baker aus Genf mit Excellente
Orchester Spieldose von George
Baker aus Genf mit
- Voix célestes, 6 Glocken,
Trommel, Kastagnetten und Zitherfunktion.
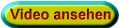
-
- A large and impressive full orchestral antique music box made by George Baker of Geneva.
-
- This box has everything going for it: 6 individually engraved and partly enamelled bells
- featuring
an array of birds and flowers; a snare drum; castanet; a retractable 18-note reed organ;
2 zither bars; large double springs for longer running time; speed control; and a tune
selector.
- The drums, bells, castanet and, unusually, the organ can all be engaged and disengaged at
- will.
The entire musical movement has been fully overhauled.
The box plays 12 operatic airs.
|
-
- In
der Mitte des Tonkamms gab es dazu eine Zungen-Sektion.
- Dazu war ein
spezielles Gebläse nötig, welches durch dasselbe Federwerk
angetrieben
wurde, das auch die Stiftwalze drehte und die Schöpfbälge
antrieb.
|

- Walzenspielwerke
mit eingebautem Harmonium kann man auch hier
ansehen.


|
-
-
|
|
-
-
-
|
|
- Hier
eine weitere sehr
interessante und wertvolle
-
- Orchestrion
Flute Spieldose mit Zungenstimmen.
- Aber
völlig
OHNE
Tonzungen (!)
-
- In
der Mitte die Zungensektion für die Harmonika,
- die Kämme
links und rechts dienen zur Steuerung
- von Glocken,
Trommel und Kastagnetten.
-
- -
Vermutl. Sainte-Croix um 1890 -
- Ratschenaufzug,
Zylinder 175x62 mm,
- 10 Melodien,
Melodienanzeiger,
20
Zungenstimmen,
- 3 Glocken, Trommel, Kastagnette.
|
-
-
-
 Datierungstabelle zu alten Walzenspieluhren
Datierungstabelle zu alten Walzenspieluhren
- nach technischen Merkmalen

|
-
-
- Zither-
oder Mandolinen- Effekt ab 1876
- Der
Zither-
oder auch Mandolineneffekt
wird im wesentlichen durch zwei Verfahren erzeugt.
-
- 1.
Durch eine Rolle "Seidenpapier" welche in
leichtem Kontakt mit dem Tonkamm- den schwingenden Tonzungen
-
gebracht wird. In der Mitte des Tonkamms befindet sich dazu
eine entsprechende Vorrichtung zum Heben und Senken.
-
- 2.
Durch Gruppen von gleichgestimmten Lamellen, die kurz
hintereinander angezupft wurden.
-
-
- Zum
Vergrößern auf das Foto klicken
|
- Mermod Fréres Walzenspieldose
-
- Auf
dem Bild links, sieht man sehr gut die Vorrichtung
- zum
An- und Abschalten des sog. Zither-Effekts.
- Wird
auch
als "Mandolinenklang" bezeichnet.
-
- Die
Papierrolle (sehr dünnes Seidenpapier)
- befindet
sich unter der rechteckigen Verblendung
- über
dem Tonkamm.
-
|
-
- Bereits bei Antoine
Favres allererster Erwähnung seiner Erfindung im Jahr
1796 wurde von vibrierenden Stahllamellen und einem "Mandolinenklang"
gesprochen.
-
- Die Arrangeure verstärkten diesen Effekt, indem sie Tremolo-Passagen einfügten.
Dafür verwendeten sie Gruppen von gleichgestimmten Lamellen, die kurz
hintereinander angezupft wurden. Herausheben liess sich dieser Effekt mit einem
Dämpfer aus Seidenpapier, der einen Teil des Tonkamms abdeckte.
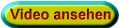
-
- Das Seidenpapier
wird durch die schwingenden Tonzungen angeregt, und
schwingt entsprechend mit. Ähnliches Prinzip wie das Kinderspielzeug
Kamm mit
Seidenpapier bespannt und mit dem Mund ansummen.
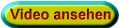
-
- Diese Zither-
oder Mandolinen Vorrichtung
weist einen Hebel auf, mit welchem der Kontakt zum Tonkamm manuell
hergestellt und wieder gelöst werden kann. Dieses
Akzessoire erschien erstmals bei hochwertigen Spieldosen, die
Jaccard-Walther aus Sainte-Croix 1876 auf einer Ausstellung
präsentierte. Dieser
Effekt ahmte also den Klang des populären Volksmusikinstruments
nach und war als Klangabwechslung sehr beliebt.
-
-
-
- Münzeinwurf engl.
= Coin operated
-
-
-
-
-
-
-
-
- Interchangeable
Cylinder Music Box ab 1850 / Wechselbare
Walzen
- Um
1850 kamen die ersten Spieldosen
mit auswechselbaren Walzen in
den Handel.
Dadurch erhielt der
Käufer die Möglichkeit, auch später noch weitere Walzen mit
neuen Melodien nachzubestellen.
-
- Noch ließen sich die einzelnen Zylinder nur auf einem bestimmten
Instrument abspielen.
Erst die fabrikmässige Produktion ab 1870 brachte kalibrierte Zylinde,
die auf jede Musikdose eines dafür vorgesehenden Modells passten.
-
-
-

- -
Mermod Freres auf einer Ausstellung -
- Der
Schweizer Uhren- und Spieldosenhersteller
- Mermod
Freres. Die Firma Mermod wurde
- 1816 von Louis Mermod in
Ste. Croix gegründet.
|
- Mermod Freres
- Interchangeable
- Cylinder Music Box
-
-
-
- This rare and monumental Interchangeable Cylinder Music Box features the largest movement ever manufactured by Mermod Frères of Ste Croix, Switzerland.
-
- It was made exclusively by special order, and sold for the princely sum of $1,000 when new in 1900.
-
|
-
-
-
|
 Auf
das Bild klicken um das Auf
das Bild klicken um das
- zugehörige
YouTube
Video
zu starten !
-
- Interessante
J.H. Heller Music Box in der Art
- eines
Swiss Chalet. Mit eingebautem Interchangeable Walzenspielwerk
- (wechselbare
Walzen) um 1870.
- -
Das Dach lässt sich abklappen -
|
-
-
-
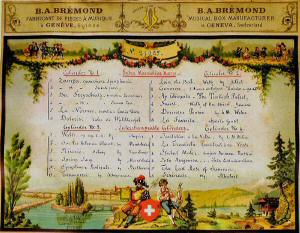 -
- Beispiel
eines Melodienzettels einer
- erstklassigen Walzen-Spieldose
um
1883
- des Genfer Herstellers
B.A. Brémond
- mit vier austauschbaren Walzen.
|
- Diese
auswechselbaren Walzen wurden gesondert für eine bestimme Spieldose
angefertigt und mit dieser auch geliefert.
-
- Eine Austauschbarkeit
mit den Walzen anderer Spieldosen Hersteller war allerdings nicht möglich
!
-
- Drei
Bilder einer Walzenspieldose kompl. mit
Aufbewahrungs-Tisch für sechs Walzen.
-
|
-
-
- Mit austauschbaren
Walzen befaßte sich hauptsächlich die Firma Mermod
Fréres aus der Schweiz.
- So
wie
man es bei
dieser schönen Walzenspiel-Dose sehen kann.

-
- Mermod
Fréres legte großen Wert darauf, dass man die Walzen in
allen Spieldosen derselben
Bauart abspielen konnte.
-
-
-
- Revolver-Spieldosen
ab 1880
-
|
|
- Mehrere Zylinder auf einen Griff standen bei Musikdosen mit drehbarer
Revolver-Halterung ab etwa 1880 zur Verfügung.
-
- Die durchschnittliche Spieldauer einer Musikdose von bisher vier
bis zwölf Melodien zu je einer Minute vergrösserte sich damit auf
das Drei- bis Sechsfache (!)
- Ähnlich einem Patronenlager waren
hier drei, vier oder sechs Walzen kreisrund angeordnet. Waren die
sechs Melodien pro Walze abgespielt, drehte sich der Mechanismus
um eine Walze weiter.
- Eine sehr schöne Detailansicht der Revolver-Mechanik
kann man auch
hier
sehen.

|
-
-
 Die
meisten Fotos lassen sich durch Anklicken vergrößern
Die
meisten Fotos lassen sich durch Anklicken vergrößern
-
-
- Duplex-Spieldosen
- Man stellte auch Spieldosen mit zwei
Zylindern her. Dass zur Fertigung dieser Duplex-Spieldosen eine
ganz besonders hohe Präzision nötig war ist selbstverständlich.
-
- Duplex
Spieldose von Ami Rivenc
- Genf um 1890
|
|
|
- Der
Mechanismus besteht aus
- zwei
synchronisierten
Spieldosen.
- Die
Verdoppelung bringt größere Lautstärke.
- Da das Lagerspiel die
Synchronizität
- beeinträchtigt,
ist die
Wiedergabequalität
- nicht
sehr
hervorragend.
- Es
gibt verschiedene Patente
für Duplex-Dosen.
|
- -
Duplex
Spieldose
- Doppeltes
Werk m. Kurbelaufzug
- und je zwei Federgehäusen.
- Vernickelt, zwei identische
- Zylinder a´
330 x 62
mm
- 10 Melodien.
- Sainte-Croix
um 1895
|
- Duplex
Spieldose
- Zwei
Zylinder 171 x 62 mm auf einer
- Achse angeordnet.
- Ratschenaufzug.
10
Melodien.
- Zwei Tonkämme
a´
30
Tonzungen
- Ami
Rivenc, Genf um 1890
-
|
-
-
-
- Plérodiénique-Spieldosen
ab 1882
- Um auch Melodien spielen zu können, deren
Länge mehrere Umdrehungen einer Walze benötigte, erfand man
die sogenannte Plérodiénique-Spieldose.
-
- Plérodiédique
Spieldose um 1890
-
- 2
Federgehäuse hintereinander.
- Zylinder
= 442 x 62 mm.
- 2 Melodien auf
6 Umgängen.
- 2 Kämme
mit
79 und 78 Tönen.
|
|
|
-
- Bei Musikdosen der Bauart "Plérodiénique" wechseln sich zwei gekoppelte
- Zylinderhälften
beim Spielen ab.
-
- Während die eine Hälfte spielt, wechselt die andere die Spur
und übernimmt danach ohne Unterbrechung die Melodie.
- Die Spieldauer einer
Melodie wuchs damit auf über fünf Minuten. (!)
-
- Hier ist der Zylinder
in der Mitte geteilt. Eigentlich sind es zwei Walzen.
- Die seitliche
Verschiebung der beiden Walzenteile geschieht nun nicht gleichzeitig,
sondern in einem bestimmten zeitlichen Abstand. Eine Walze spielt,
die andere wird in der Zwischenzeit seitlich verschoben. So
können Melodien bis zu sechs Umgängen ohne Unterbrechung abgespielt
werden.
- Dieses
System wurde 1882 von A. Jeanrenaud für die Fa. Paillard patentiert
und ist sehr selten.
-
-
-
- Semihelicoidal-Spieldosen
- Bei Musikdosen mit helikoidaler, also schraubenförmiger Anordnung der
Stifte, wird der Zylinder während des Spiels auch noch seitlich verschoben.
Wie
beim System Plérodiénique werden sämtliche Stifte für ein einziges,
durchgehendes Arrangement genutzt.
-
- Diese
Spieldose erlaubt ein kontinuierliches
Spiel über mehrere Umdrehungen
des Zylinders. Die Stifte folgen dem Spurwechsel. Ein spezieller
Mechanismus gestattet das Abstellen nach dem Ende jeder Melodie,
obwohl diese jeweils mitten in einer Umdrehenung aufhören.
- Am
Ende der 6. Umdrehung wird durch eine spezielle Vorrichtung
der Zylinder vom Tonkamm wegbewegt, um das Zurückkehren auf
die 1. Spur zu ermöglichen. Ohne diese Bewegung würden die Zylindestifte
den Tonkamm beschädigen.
|
|
- Semihelicoidal
Spieldose
-
- Zylinder
430 x 80 mm, drei unterschiedlich
- lange
Melodien auf 6 Umgängen,
- 2
Kämme mit 82 und 81 Tönen.
- >
Vermutlich Genf um 1890 <
|
-
-
- Sublime-Harmonie
Spieldosen
- Im Jahre 1874 entwickelte Charles Paillard ein System mit zwei oder mehr
Tonkämmen, die je eine vollständige Tonreihe enthielten. Gleich hohe Töne
wurden dabei schwebend gestimmt. Beim gleichzeitigen Anzupfen nahmen sie so je
nach Stimmung an Intensität zu oder ab. Musikdosen dieser Bauart erhielten das
Etikett "Sublime Harmonie"
-
- Die
Tonkämme werden leicht verschieden - schwebend - gestimmt, so
dass beim Zusammenklingen ein intensiver Klang entsteht.
-
-
- Paillard
Sublime Harmonie Tremolo Spieldose.
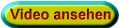
|
- Paillard Sublime Harmony Tremolo
Spieldose
um 1885,
Zither-Mechanik. 3 Tonkämme.
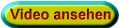
|
- Sublimen Harmonie Spieldose
mit 2 Tonkämmen. Für 4 austauschbare Zylinder
- mit je 6
Titeln. Vermutlich
von Mojon Manger in Genf um 1890 hergestellt.
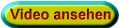
|
-
-
- Sublime-Harmonie
Spieldose
- von
J.H. Heller
aus Bern, um 1880
- 4
getrennte Tonkämme 37, 37, 24, 24 Töne.
- Zylinder
432 x 61 mm, 8 Melodien.
-
- Bei
dieser Dose sind die beiden rechten Kämme
- gleich gestimmt. (Sublime-Harmonie-Disposition)
- Die
beiden linken Kämme werden für die
- Akzentuierung
der
Melodie gebraucht.
-
|
|
- Sublime-Harmonie
Orchester Musikdose
- Hersteller:
Mermod Frères in Ste-Croix ca. 1885.
- Werk
vernickelt, 3 Chinesen schlagen auf 6 Glockenschalen.
- Man
sieht deutlich die 2 Kämme, der Sublime-Harmonie
Mechanik.
- Zylindergröße:
29 x 7 cm. Gehäuse: 65 x 38 x 32 cm.
|
|
-
 YouTube Video
YouTube Video - Die Herstellung
einer
- Walzenspieldose
in heutiger Zeit
-
|
-
-
- Es ist unglaublich
was in dieser Zeit
- alles
erfunden und patentiert wurde....
-
|

- Jacot´s
Safety
Check von 1886
|
- ....zum
Beispiel der sogenannte "Fallschirm"
 der bei einem
Zahnradbruch das Werk sofort blockiert und zum Stillstand bringt.
der bei einem
Zahnradbruch das Werk sofort blockiert und zum Stillstand bringt.
- Das
war Jacot´s safety check. Sein Patant vom 22. sept. 1886.
-
- Oder der mechanische Geschwindigkeitsregler
für eine stufenlose Veränderung der Geschwindigkeit. Der geräuschlose
Aufzug, der Kurbelaufzug usw.......
| |